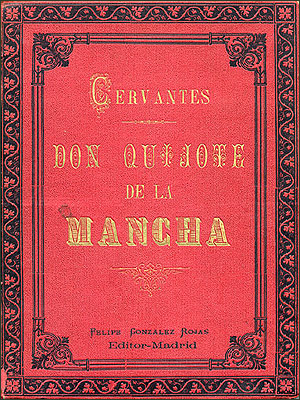Quijottes zweite Aventiure
|
Nach
dem schon erwähnten Abenteuer mit dem Puppenspiel kommt im Kapitel
II eine der merkwürdigsten Aventiuren der Novelle, in der Don
Quijote über das unvermeidbare Schicksal der Ritter spricht: ihre
Leben und jetzt auch seines, war von der Providenz vorherbestimmt. Nur
die Hand Gottes, dem sie dienen, kann sie führen: Seine
Übermächtigkeit kann sie wunderbar helfen oder schrecklich
schlagen. Die Art und Weise, wie Cervantes dieser Philsophie des Lebens
parodiert, wird hier analysiert Das
hier zu analysierende Abenteur in II, 29 ist nun das
letzte Abenteuer, das don Quijote und Sancho vor der Ankunft am Hof der
Herzöge
erleben und das in deutlichem Kontrast zu dieser Vereinnahmung steht:
Am Ufer
des Flusses Ebro erblickt don Quijote, wie im ersten Teil, durchaus
aktiv einen
Anlass für seine ritterliche Bewährung. Don
Quijote kommt, nachdem er in die Höhle des Montesinos
hinabgelassen
wurde und maese Pedro alias Ginés de Pasamonte als Puppenspieler
wieder
begegnet ist, an den Ebro, an dem zunächst scheinbar eine
bukolische
Liebeslandschaft aufgerufen wird, die don Quijote „amorosos
pensamientos“ also
„Liebesgedanken“ eingibt. Das ritterliche Paradigma gewinnt jedoch
schnell
wieder die Überhand, als er am Ufer des Flusses ein ruderloses
Boot vertäut
sieht, das er als persönliche Aufforderung betrachtet, ein
Abenteuer zu
bestehen. Also belehrt er Sancho mit einer kleinen Abhandlung zur
Bedeutung der
Situation aus seiner ritterlichen Erfahrung heraus: „Du
mußt wissen, Sancho, der Nachen hier ist dazu da, und
anders kann es nicht sein, mich zu rufen und aufzufordern, daß
ich hineinsteige
und darin fortschiffe, um Beistand zu leisten irgendeinem Ritter oder
sonst
einer hilfsbedürftigen Persönlichkeit, die gewißlich
von großen Nöten bedrängt
sein muß; denn so pflegt es in den Ritterbüchern zu sein und
bei den Zauberern,
die mit solchen Geschichten zu tun haben; wenn ein Ritter sich in einer
Drangsal befindet und aus selbiger nur durch eines andern Ritters Hand
erlöst
werden kann, obgleich sie zwei- oder dreitausend Meilen, ja noch weiter
voneinander entfernt sind, da entführen sie ihn gewaltsam in einer
Wolke oder
bieten ihm einen Nachen dar, damit er dareinsteige, und in
kürzerer Zeit, als
man die Augen öffnet und schließt, führen sie ihn
davon, sei es durch die
Lüfte, sei es das Meer hindurch, wie es ihnen beliebt, und wo sein
Beistand
notwendig ist.“ (Übers. Braunfels, 767) In
dieser kurzen Passage verdichten sich wichtige Moment
der Sujet- als auch der Raumstruktur der Ritterromane: der klassische
Ritter,
dem don Quijote nacheifert, operiert in einer von Providenz bestimmten
Welt, in
der kein Element zufällig, sondern jeweils Wink eines Schickals
ist: Boote,
selbst wenn sie ohne Ruder sind, liegen nicht einfach so am Ufer
vertäut,
sondern sie sind dafür bestimmt, dass der Ritter sie nutzt, weil
eine höhere
Macht (hier ein „encantador“) sie mit ihnen als Transportmittel an
einen vorbestimmten
Ort bringen soll, wo ein Abenteuer auf ihn wartet, hat, das z.B. darin
besteht,
einem anderen Ritter zu helfen. Hierbei kann sich don Quijote in der
Tat auf
Vorbilder aus dem Ritterroman berufen, wo das verzauberte Boot –
insbesondere
in der arthurischen Tradition – eine lange Vorgeschichte hat. Raum
und Zeit werden zu bloßen Funktionen einer
Sujetstruktur, sie haben kein Eigengewicht. Genau
dieser Erwartung an ein ritterliches Raumzeitgefüge
verleiht nun don Quijote Ausdruck, wenn er davon spricht, dass, wenn es
um eine
Hilfeaktion für einen anderen Ritter ginge, Zauberer bewirken
könnten, dass er
instantan über mehrere Tausen Meilen hinweg in einem Boot oder
einer Wolke
versetzt werden könne. Auch
diese instantane Versetzung im Raum hat durchaus
konkrete Vorbilder: Hier soll vor allem der der vielleicht
unmittelbarste
Prätext der Episode untersucht werden, nämlich ein Abenteuer
aus dem Palmeirim
de Inglaterra. Cervantes’
parodistische réécriture der Palmeirim-Episode
macht sich diese Ortlosigkeit des Ritterromans zu Nutze, um die ferne
Geographie des Wunderbaren mittels Intertextualitätssignalen mit
einer
spanischen Nahwelt des Alltags zu überblenden, und verwendet
dafür die für den
Roman typische Doppelperspektivierung: Wo don Quijote wie Palmeirim
einen Wink
des Schicksals sieht, der ihn aufs offene Meer führt, sehen Sancho
und mit ihm
der Erzähler nur ein – noch dazu ruderloses – Fischerboot auf dem
Ebro. So
warnt Sancho, wie Palmeirims Knappe Selvião, auch entschieden,
aber vergeblich
davor, sich auf das Abenteuer einzulassen, und geht doch
schließlich ängstlich
selbst mit auf die Reise. Angesichts seiner Angst ermahnt ihn don
Quijote mit
den folgenden Worten: „Was
fürchtest du, feiges Geschöpf? Worüber weinst du,
Butterherz? Wer verfolgt dich, wer bedrängt dich, du Maus, die
sich im Loche
duckt? Oder was geht dir ab, und darbst du etwa im Schoß des
Überflusses?
Pilgerst du etwa zu Fuß und barfüßig über die
Rhypäischen Gebirge oder sitzest
du nicht vielmehr hier, wo eine breite Planke dir einen Sitz
gewährt wie einem
Erzherzog, auf der geruhsamen Strömung dieses lieblichen Flusses,
von wo wir
nach kurzer Weile in das weite Meer hinausfahren werden? Aber schon
müssen wir
hinausgekommen und mindestens sieben- oder achthundert Meilen weit
gefahren sein
(...)“ (768) Don
Quijote glaubt also, während der Kahn gemächlich den
Ebro hinuntertreibt, tatsächlich an die quasi-momenthafte
Versetzung im Raum,
wenn er davon ausgeht, bereits ein gutes Stück des Weges
zurückgelegt zu haben,
d.h. 700 oder 800 Meilen von insgesamt 2000 oder 3000. In der Folge
geht es mir
weniger um die evidente komische Brechung dieser Annahme angesichts des
ruhigen
Treibens des Kahns auf dem Fluss, in ständiger Sichtweite des
Ufers und des
dort angebundenen Rocinante sowie Sanchos Esel, sondern vielmehr um die
vorstellungsmäßige Veränderung, der don Quijote die
Wunderwelt des Ritterromans
unterzieht. Bereits die Tatsache, dass er die Versetzung im Raum
überhaupt in
Zahlen auszudrücken bemüht ist, deutet den entscheidenden
Umschwung an: Don
Quijote hat eine präzise geographische Vorstellung der Räume,
durch die er sich
scheinbar bewegt – dadurch ist er in der Lage, eine zumindest
prinzipielle
Kontinuität zwischen dem Fluss, auf dem er sich tatsächlich
befindet, und dem
Meer, auf das er hinauszufahren glaubt, herzustellen. Zu
Beginn des zweiten Teils des Romans beklagt sich don
Quijote, dass kein Ritter – er meint damit offensichtlich die
Höflinge am Hof
des Königs – mehr bereit sei, sich den körperlichen Strapazen
einer
authentischen Ritterschaft auszusetzen, wobei er als ein Beispiel unter
anderem
die Bereitschaft nennt, in ein am Meeresrand bereit liegendes Boot
einzusteigen, womit der das Abenteuer in II bereits vorwegnimmt: „[Jetzo
gibt es] keinen mehr, der, aus dem Wald hier
hervorstürmend, in des Gebirge dort eindringen würde und von
da aus ein
unfruchtbares, wüstes Gestade beschreiten am Rande der See, der
fast immer
stürmischen und wildbewegten, und der sich am Meeresstrande
unverzagten Herzens
in einen kleinen Kahn ohne Ruder, Segel, Mast und Tauwerk, den er dort
gefunden, hineinwerfen würde und sich preisgäbe den
unerbittlichen Wogen des
tiefen Meeres, die ihn bald zum Himmel emporschleudern, bald in den
Abgrund
hinabreißen. Und er, die Brust dem unwiderstehlichen Sturmestoben
bietend,
plötzlich, im Augenblick, wo er sich dessen am wenigsten versieht,
findet sich
über dreitausend und mehr Meilen entfernt von dem Orte, wo er zu
Schiff
gegangen; und wie er nun ans Land springt, ein entlegenes und
unbekanntes Land,
da begegnet ihm gar vieles, das würdig ist, nicht auf Pergament,
sondern auf
Erz niedergeschrieben zu werden.“ (554) Als
Ausweis der Authentizität seines Rittertums fungiert
für don Quijote dabei in erster Linie der Körpereinsatz, der
seiner
Einbildungskraft zu Hilfe kommen, sie realisieren muss. Und indem er
als sein
persönliches Feindbild die Faulheit der Höflinge beschreibt,
die nicht in der
Lage seien, Ritterlichkeit tatsächlich körperlich
auszuagieren, nennt er damit,
ohne es zu wissen, den Prototyp einer konsequent modernen Imagination,
die
nicht darauf angewiesen ist, sich körperlich auszuagieren, sondern
die sich mit
imaginären Reisen begnügt. In Kapitel II, 6 taucht der in der
Zeit Cervantes’
weit verbreitete Topos des imaginären Reisens wiederum in
Zusammenhang mit einer
Kritik der faulen Höflinge auf, als don Quijote seine „ama“, seine
Haushälterin, über den Unterschied zwischen fahrenden Rittern
und Adligen am
Hof belehrt: „Sieh,
meine Liebe“, antwortete Don Quijote, „nicht alle
Ritter können Hofleute sein, und nicht alle Hofleute können
oder sollen
fahrende Ritter sein. Es muß von aller Art Leute in der Welt
geben, und wiewohl
wir insgesamt Ritter sein mögen, so ist doch ein großer
Unterschied zwischen
den einen hier und den anderen dort. Denn die Ritter vom Hof, ohne ihre
Gemächer zu verlassen und die Schwelle des Königshauses zu
überschreiten, die
spazieren auf einer Landkarte durch die ganze Welt, und es kostet sie
keinen
Pfennig, und sie erdulden dabei nicht Hitze noch Kälte, weder
Hunger noch
Durst; wir aber, die wahren, die fahrenden Ritter, in Sonnenglut und
Frost, in
freier Luft und in allem Ungemach des Wetters, bei Tag und Nacht, zu
Fuß und zu
Pferde, wir durchmessen die weite Erde mit unsern eignen
Füßen. Und nicht nur
Feinde in Abbildungen kennen wir, sondern solche von Fleisch und Blut
(...)“ (586) |